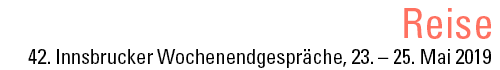Die Ästhetik der Pressereise – und jene der Reisetexte
Reisen und Schreiben als Berufsbild
Seit 15 Jahren absolviere ich Pressereisen. Früher fuhr ich für den „Standard“, heute mache ich die meisten für die „Presse“ und die eine oder andere für die „Süddeutsche Zeitung“. Ich war in Neuseeland und auf den Malediven, im Oman, in Monte Carlo, der Emilia-Romagna, am Klopeinersee und an 150 anderen Orten. Dort, wo Fluglinien, Tourism-Boards, Hotels und Reiseveranstalter uns Journalisten in der Hoffnung hinschicken, dass wir über ihre Destinationen berichten.
Aus dieser Grundkonstellation konnte ich nicht anders als für die eigene Produktion zu lernen. Denn eines steht fest: Der Job des Reisejournalisten hat viel mit Oberfläche zu tun. Ich bin kein Rucksacktourist, der sich treiben lassen, und kein Auslandskorrespondent, der sich einarbeiten kann. Ich mache fünfzehn Pressereisen im Jahr. Daher darf ich nicht für mich beanspruchen, Experte für das jeweilige Thema zu sein. Die Längen meiner Aufenthalte, oft zwischen zwei und sechs Tagen, helfen auch nicht gerade, allzu tief in die Materie einzutauchen. Das Wichtigste beim Verfassen der Texte scheint mir, diesen Mangel an genuinen Erfahrungen mitzubedenken. Die eigene Position beim Beobachten einzuberechnen ist mindestens so wichtig wie das Beobachten selbst. Wer den Mund aufreißt, als würde er sich auskennen, hat schon verloren.
Ich versuche, meine Geschichten über Orte, die ich oberflächlich kenne, so konzentriert zu verfassen, dass zunächst die Fehlerquellen minimiert werden. Keine Verallgemeinerungen, keine Behauptungen, kein „Wissen“, und nur nichts nachplappern. Außerdem wird die Schreibweise jedes Fremdwortes nachgeprüft. Ich scheue keine Anstrengung, um mir die Kritik der Spezialisten zu ersparen. Ich habe bei Pressereisen meine Taktik. Vor Ort meide ich Guides, sofern es die Höflichkeit erlaubt. Was mir ein Fremdenführer in einer Stunde erzählen würde, kann ich auf Wikipedia in fünf Minuten nachlesen. Mein Interesse liegt auch nicht in der gehobenen Küche – eher im Eckcafé. Dort krieg ich am meisten Material.
Ich schreibe für sogenannte „Qualitätsmedien“ und bin deswegen recht frei in dem, was ich mache. In Boulevardzeitungen setzt Reisejournalismus wegen der schieren Menge der Leser auf direkte Ergebnisse. Die Destination wird in primitiven Worten beschrieben, und in der Info-Box stehen die Preise. Vielleicht gibt es noch eine Kooperation zwischen Zeitung und Veranstalter. Die Texte im Boulevardsegment funktionieren immer nach dem gleichen Strickmuster: „XY Land: Zwischen Tradition und Moderne.“ Ein solcher Stil setzt sich aus Sprachtools zusammen, die sich beliebig variieren lassen. Um ihn zu produzieren, müsste sich kein Journalist auf eine Reise begeben haben. In zwei bis drei Stunden ließen sich solche Texte zusammenkopieren. (Das Bittere ist jedoch, dass sich sehr wohl Menschen auf Pressereisen begeben, die sich dann auch von der Spannung zwischen Tradition und Moderne verführen lassen.)
Beim Schreiben über die Reise geht es zunächst um die Erzählhaltung: Ganz egal, wie ich gereist bin, das erzählerische „Wir“ kommt mir nicht in den Text, das „Ich“ nur in Ausnahmefällen. Meine Kunst als Reiseautor soll darin bestehen, das Ego und die lächerlichen Kleinerlebnisse ebenso im Hintergrund zu halten wie die vorgefertigten Klischees über Land und Leute. Ohne das „Ich“ muss es mir gelingen, den Lesern doch die feste Gewissheit zu geben: Hier schreibt einer, der vor Ort war und persönliche Erfahrungen gemacht hat. Das ist mein Hauptkriterium für einen guten Reisetext.
Martin Amanshauser