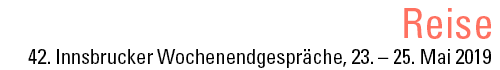Literatur und Reisen
Es geht beim Reisen um dreierlei: um Langeweile, Verstörung und Wunder. Das Wunder ist ohne die Langeweile nicht zu haben. Die Verstörung lässt den Reisenden (der immer auch Tourist bleibt, wie besonders er sich auch vorkommen mag) an sich – aber mehr noch, am Wunder – zweifeln. Ohne die Momente der Verstörung wäre das Wunder aber nichts wert. Im Schreiben kann man das Spannungsfeld zwischen diesen Momenten zeichnen; ein zartes und flexibles Netz.
What am I doing here, heißt Bruce Chatwins letztes Reisebuch; diese Frage stellt sich jeder Tourist und jeder Reisende. Was mache ich eigentlich hier: stundenlang auf Flughäfen, in Flugzeugen oder auf Autobahnen, diesen Nicht-Orten, bestenfalls in Zügen; in winzigen Hotelzimmern mit Aussicht auf einen Luftschacht; während endloser Spaziergänge durch Innenstädte oder Museen; holpriger Unterhaltungen in Sprachen, die keiner der Gesprächsteilnehmer beherrscht; langwierigen Irrgängen auf der Suche nach einem Restaurant, die fast unfehlbar genau dort enden, wo man nicht hinwollte.
Aber dann.
Gerade die Langeweile, die den eigenen Körper spürbar macht und ihn in die Umgebung versetzt, ist Voraussetzung für das Wunder.
Das Wunder muss gar nichts besonders Spektakuläres sein: wenn es eine Intensivierung der Zeit ist, eine Intensivierung des Gefühls, jetzt gerade hier zu sein, an diesem Ort, und in einer besonderen Beziehung zu diesem Ort zu stehen, ein winziges Vibrieren zu fühlen. In irgendeiner Straße einer fremden Stadt oder halb verirrt in einer Landschaft oder auch nur mit geschlossenen Augen im warmen Meer treibend. Und plötzlich ist man im Innern des Traums, der einen dazu gebracht hat, wegzufahren.
Einmal bin ich durch die sandigen Straßen der Altstadtinsel von Saint-Louis im Senegal herumgestreunt, zwischen den bunten niederen Häusern, ziegenhütenden Kindern, während Männer und Frauen in Boubous um die Ecken huschten, und ich hatte, mit einer Art naivem Erstaunen, das Gefühl: ich war jetzt wirklich in Afrika. Alles war besonders; ich war nicht ich selbst, sondern irgendjemand aus einem Film oder Buch.
Im Innern des Traums; das rund um mich war nicht nur Kulisse; aber einen Schritt entfernt wartet die Wirklichkeit.
Ich ging über die Brücke in den nicht ganz so pittoresken, aber anziehenden, nur durch einen Flussarm von der Altstadtinsel getrennten Stadtteil der Fischer. Zwei Männer fingen mich gleich ab, denn in diesem Stadtteil mag man keine europäischen Touristen. Die beiden Männer wollten mir nichts tun, sie wollten mich nur schützen und mir etwas erzählen: nämlich, dass von hier aus die menschenüberladenen Boote zu den Kanarischen Inseln aufbrechen, weil die Meere von den großen europäi¬schen Fangflotten leergefischt sind und es keine Lebens¬grundlage für die Bewohner mehr gibt. Ich erinnerte mich an die Friedhöfe, die ich auf Lanzarote einmal gesehen hatte, an die Gräber Unbekannter mit beiläufig hingekritzelten Aufschriften wie Migrante No 1., Imigrante Numero 10 Varón. Eine große Tragödie unserer Zeit, sage ich ernst und mit dem Gefühl, auf lächerliche Art Würde zu heucheln; denn ich kann weder Europa noch mich selbst verteidigen, noch kann ich groß helfen, und wenn ich erklären sollte, wozu ich hier bin, müsste ich sagen: um schöne Fotos zu schießen und eine Erfahrung gemacht zu haben.
Und nun habe ich eine Erfahrung gemacht, eine ungefährliche, einsortierbare und nur sanft demütigende und verunsichernde Erfahrung; eine Erfahrung, die ich aufschreiben kann. (Ich gehöre zu den Touristen, zu denen, die sich durch die Welt bewegen, aber sich sicher sind, auch wieder zurückkehren zu können. Die immer eine zweite Welt in Reserve haben.)
Was mache ich hier: ich suche das Wunder. Und die Verstörung. Ein gesteigertes Wirklichkeitsgefühl; ein Bewusstsein für das Kippen einer Situation ins Gefährliche, Verunsichernde oder Wunderbare, für das Nie-Wieder des Moments. Was passiert, wenn dieses Bewusstsein paradoxerweise gerade zum Schreiben – zum Versuch, den Moment festzuhalten, wenngleich in einem neuen anderen Raum – führt? Wieder nur in die zweite Welt hinein, die man in Reserve hält: Ist das ein Scheitern? Und wenn ja, ist das schlimm?
Thomas Stangl